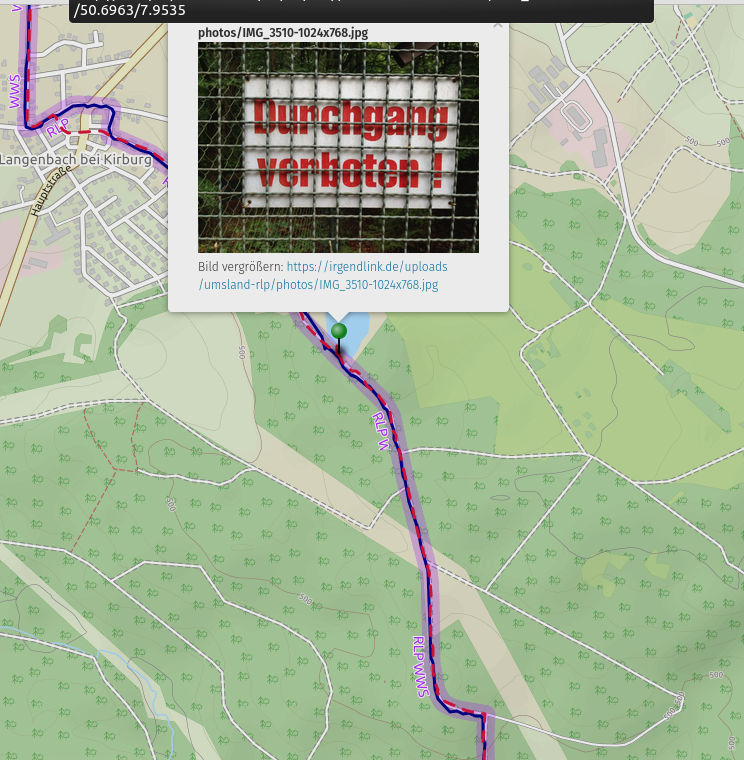Ich müsste mittendrin beginnen.
Ein Platzregen geht nieder. Blitz, Donner, Getöse. Alles andere an Wetterstimmung als rundumes Wohlgefühl. Beklommen sitzen wir unter dem kleinen Baldachin vor der Pforte des unheimlichen alten Seniorenstifts. Der Journalist F. und ich. Der Regen ist so stark, dass gerade mal sein Rollstuhl Platz findet und ich mit dem Po auf der Stuhlkante in einem Terrassenstuhl hin und her rutsche. Der einzige von etwa fünf Terrassenstühlen, auf dem noch ein Sitzkissen liegt. Der einzige, der im Trocknen unter dem Zeltdach ist. Von allen anderen hat das Pflegepersonal die Sitzkissen entfernt. Sherlockesk rattert mein Hirn und stellt zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Entweder ist die Person, die, kurz bevor das Unwetter losging, die Sitzkissen wegräumte, mit der Regenwasserspritzsituation unter dem Zelt so vertraut, dass sie weiß, dass auf genau diesen einen Platz kein Spritzwasser kommt, oder es saß noch jemand auf dem Stuhl, als die Sitzkissen abgeräumt wurden und in einer wasserdichten Terrassensitzkissenkiste hinter den Stühlen verstaut wurden.
Ich muss an Winnie Heller denken, die Fernsehkommissarin, die kürzlich in der letzten Folge der Krimiserie, nachdem sie den Fall gelöst hatte, vor die Tür eines alten feinen Gebäudes im Grünen trat und vom Blitz erschlagen wurde. Nicht übel, dieses Finale. Gefiel mir irgendwie. Es war ja nur ein Film. Hier das ist Realität. Dieser fette, mittelgraue Dunst, die Schwerlastwolken, die sich die letzten Tage übers Land schieben. Ich weiß gar nicht, wie ich die Nacht vor ein paar Tagen, es war Freitag auf Samstag, schutzlos radelnd zwischen Hunsrück und Pfälzer Wald so angstlos überstanden hatte. Wetterleuchten ringsum und ich mit kaum Gepäck, nur eine Regenjacke hatte ich dabei, und ein bisschen Essen auf fünfzehnstündiger Fahrradtour. Nachts zwischen Hunsrück und Pfälzer Wald ist man mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Wenn ein Platzregen niederginge, ein Unwetter, Hagel und so weiter, wäre jeder Kilometer zu viel, den ich radeln müsste, bis ich eine Schutzhütte finde, ein Vordach oder eine Scheune irgendwo. Da wäre es auf Minuten angekommen und dann, dann hätte ich womöglich Stunden warten müssen ohne wärmende Kleider – während der Nachtradeltour kam mir der Bericht eines Ultramarathons in den Sinn, bei dem kürzlich in China etliche Athletinnen und Athleten ums Leben kamen. Überrascht von einem Unwetter mit Temperatursturz, das sie in die Orientierungslosigkeit getrieben hatte, sie umher irrten zwischen Kilometer Null und Einhundert und schlichtweg erfroren oder vor Erschöpfung liegen blieben.
Der Journalist F. und ich rauchten eine Zigarette und da der Regen nicht nachließ und im Seniorenstift das Abendessen serviert wurde, schob ich ihn zur Tür, nur drei vier Meter, unser ultimativer Ultramarathon am Rand unserer stark angelebten Leben, ein kurzes Tschüss, machs gut, bis bald und bis ich die hundert Meter beim Auto war ganz ohne Schirm war ich klatschnass, die Scheiben beschlugen sofort.
Die letzten Wochen waren für den Journalisten F. ein massiver und traumatisierender Umbruch. Von der Klinik brachte man ihn direkt in die Kurzzeitpflege des Seniorenstifts, auf der Bettkante teilentmündigt, denn das Klinikpersonal schätzte ihn, nicht ganz zu unrecht, so ein, dass er sich alleine zu Hause nicht mehr helfen könnte. Wenn es nur darum ginge, die Treppe in der ersten Stock seiner Wohnung zu bewältigen. So regelt nun eine Sozialarbeiterin seine Belange. Meine Person kam ins Spiel, als es darum ging, die Wohnung zu räumen, denn neben den körperlichen Problemen hatte sich auch einiges an materiellen Querelen aufgetürmt.
So war ich also ein zwei Wochen damit beschäftigt, die Journalistenwohnung nach persönlichen Dingen und einigen wenigen Möbelstücken zu durchsuchen und diese bei mir im Atelier zwischenzulagern, bis der Freund hoffentlich irgendwann nach der Kurzzeitpflege ein größeres Einzelzimmer kriegt. Die Wohnungsräumung war selbst für mich als relativ Unbeteiligter ein wehmütiger Akt. Ich kann mich so schlecht abgrenzen und denke bei Menschen, denen ich helfe, immer auch, ich könnte dieser Mensch sein und wie mag es sich wohl anfühlen. Gefährlich, wenn man dabei zu tief in die Situation geht.
Nach etlichen Fahrten hatte ich die wichtigsten Dinge ins Zwischenlager gebracht und auch schon den PC ins winzige Zimmer des Seniorenstifts. Vielleicht der erste und einzige PC in Patientenhand, den das Stift jemals sah. Auch dürfte Journalist F. der jüngste Bewohner sein. Das Stift ist ein altes barockes Gebäude mit zwei Flügeln, das einmal ein Kloster war. In der Werbung auf der Homepage ist man besonders stolz auf den angegliederten Park voller uralter Bäume, ja, der ist wirklich schön. Da oben im Türmchen wird Dein neues Zimmer sein, scherze ich mit dem Journalisten. Der Turm sieht jedoch mehr nach Taubenschlag aus, aber dennoch, mit ein bisschen Phantasie … hätte was. F. kokettiert gerne damit, dass er nun alles hat, was er sich immer gewünscht hat: ein Stadtschloss und Personal.
Leider sieht die Realität ganz anders aus. Ein Blick in die Pflegehölle. Eingelagertes Fleisch, das, zwar professionell – manchmal auch herzlich – umsorgt aufs Ableben wartet. Typen wie Journlist F. sind in dem System nicht abgebildet und entsprechend schwer hat er es dort. Es sind Kleinigkeiten, denkt man, die Art wie man ihn anspricht, bemutternd bevormundend tadelnd, wenn sein kleines Zimmerchen etwas unordentlich ist etwa. F. könnte theoretisch von seinem PC-Arbeitsplatz auch arbeiten, aber es gibt kein Wlan im Haus. Nicht für die Patientinnen jedenfalls.
Manchmal denke ich darüber nach, dass ich das alles aufschreiben sollte. wieder bloggen sollte. Mitschreiben als eine Art privater Chronist des eigenen Lebens, scheißegal, wen es interessiert, ein Mann ein Blog, so wie früher, mach was draus, du Chronist des eigenen Lebens und des Lebens derer, die dein eigenes Leben kreuzen und all der anderen weltbewegenden Dinge, die da draußen vorgehen.
Ich müsste mittendrin beginnen. Und vor allem sollte ich mir das Schreiben wieder zur Angewohnheit machen. Ich muss, fürchte ich, mich zu diesem Funken Disziplin zwingen.