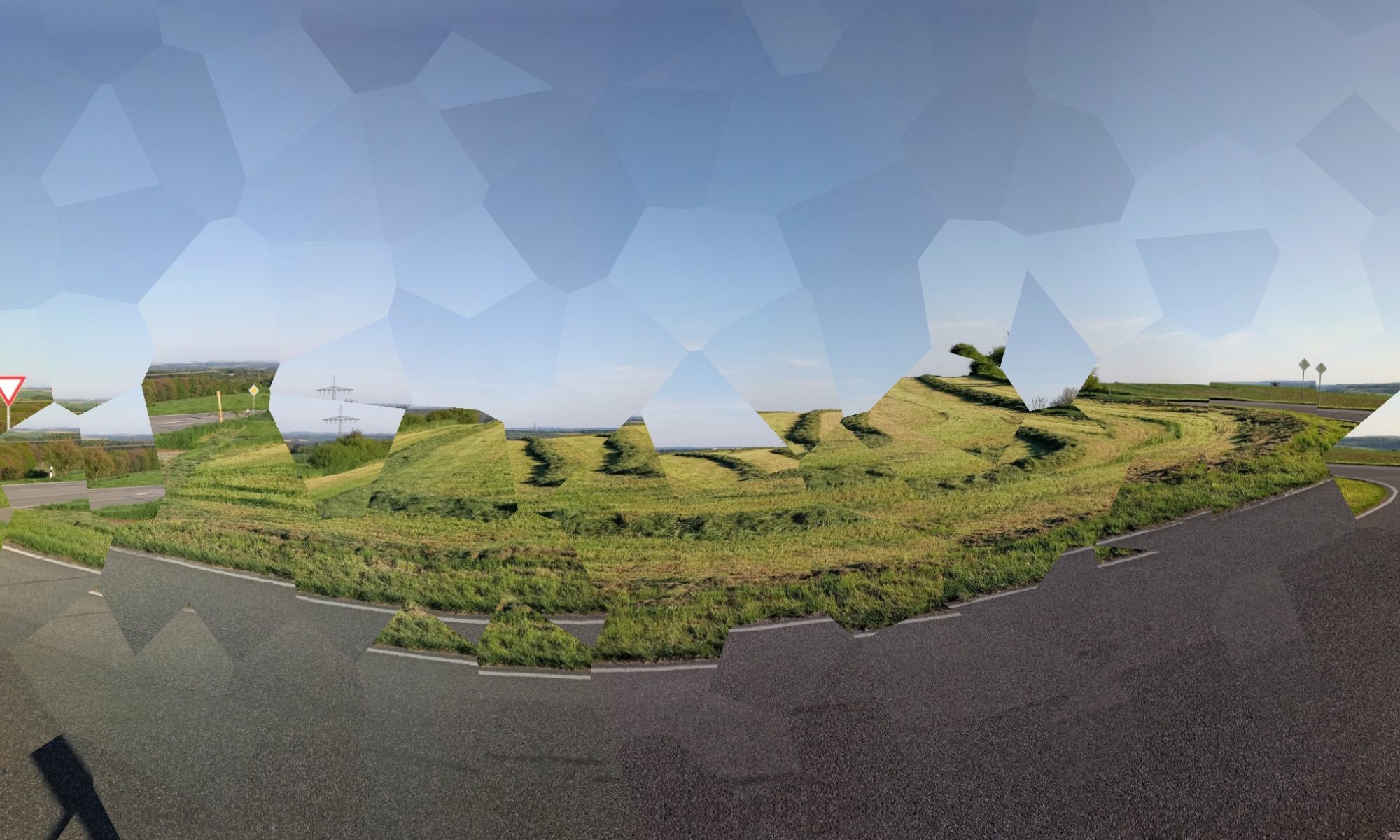In den letzten Monaten häufen sich die Spamkommentare von Maschinen, die doch tatsächlich den jeweiligen Blogtext aufgreifen und ihren künstlich generierten Senf dazu geben. Zitat aus Dauer, Kalender und UmsLänder:
Haha, ja, die Software-Updates sind manchmal ein kleines Desaster! GIMP, Inkscape und Scribus vergessen – das klingt nach einem Abenteuer in der Software-Wüste. Und die Landkarten-Tools? Da wird man doch fast zu einem Cartographen! Aber der Gedanke an einen Artikel über Dauer ist ja Gold wert, besonders wenn man dabei Dosen sammelt – eine echte Kombination aus Kunst und Recycling. Lächerlich, dass man sich über so etwas Gedanken macht, aber ja, das ist doch das Leben! #Kunst #Dauer #Humor #Fediversehẹn
Meine Blogs sind vermutlich längst im Bauch der internationalen künstlichen Intelligenz und geben dort Nährstoffe ab an den heranwachsenden großen Organismus. Ich frage mich, ob durch dieses massenhafte „Verschlucken“ von Information Manches wahr wird, was ich erfunden habe. Irgendwann wird womöglich die MudArt tatsächlich existiert haben, tauchen frei erfundene Namen von Medien auf, die darüber berichteten, werden Journalistinnen und Journalisten als echt zitiert, die es nie gegeben hat und mein Alterego Heiko Moorlander erhält eine per Maschinen-Intelligenz verbriefte hochoffizielle Existenz?
Ein Prompt-Spaziergang vor zwei Jahren kommt mir gerade in den Sinn. Im Rahmen des Metalabors neun im Taunus wanderten wir durch den Taunus. Podcaster H. führte mir auf dem Smartphone vor wie die Maschine per Sprachbefehl ein Lied für uns komponieren kann. Ich sollte ein paar Angaben machen über Musikstil und Liedtext und zack gabs ein Lied. Es fühlte sich an wie ein Horoskop-Blendwerk: Hinterher fügt das eigene Hirn die Elemente so zusammen, dass es stimmig ist. Sprich, unser gepromptetes Lied schien genau das, was ich der Maschine diktiert hatte. Es war kein gutes Lied. Ein Allerwelts-Lullifulli-Gesängchen, aber für den Mainstream hätte es durchaus getaugt.
Den Maschinen ist es egal, was sie ausgeben, Text, Musik, Bild, Video sogar. Als Basis dient bestehendes, einst von Kreativen Geschaffenes.
Ich frage mich, ab wann das System in die Rückkopplungsphase kommt, in der die Maschinen ihren eigenen Output reinterpretieren, ob es dann zu einer Intelligenz-Resonanzkatastrophe kommt.