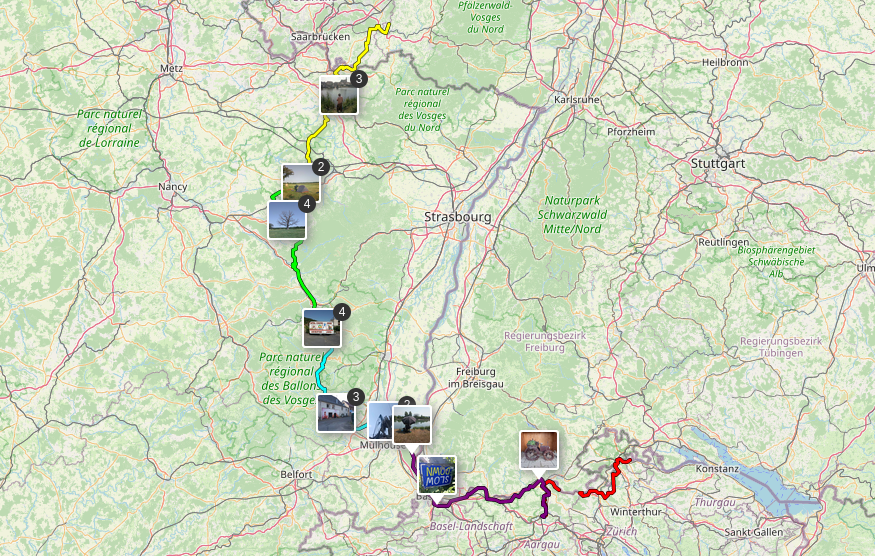Ein schmutziger Schwan. Ein ruhiger Fluss. Leichter, noch kühlender Wind, bestes Wetter, Stille, zwei frühe Hundegassigängerinnen.
Etwa hundert Meter hinter mir steht ein Biokompostklo, daneben ein Schild, das diesen Streifen Rheinufer als Naturschutzgebiet ausweist. Zelten ist verboten. Und daran hielt ich mich auch, begab mich zurück in den dichten Wald, der, so sagte mir die Vernunft, doch eigentlich auch ein Naturschutzgebiet sein müsste. Einerlei, tu das, was die Schilder sagen und wenn keine Schilder da sind, die etwas sagen, tu was du willst, aber halte die eigene Vernunft im Blick.
Die einzige Zeltmöglichkeit fand ich bei einem kleinen Teich, der auf der Karte mit „Seeroseteich“ verzeichnet ist, Seerose ohne N. Da es schon fast dunkel war, baute ich das Zelt auf, aß meinen Nudelsalat, den ich zuvor im Denner in Eglisau gekauft hatte, trank ein Bier, sinnierte über Insellagen.
Wie es sich wohl anfühlt, Frosch zu sein in diesem Teich, fragte ich mich. Muss es nicht so ähnlich sein wie Mensch auf diesem Planeten? Eine Insel, die man, bzw. Frosch, nicht verlassen kann. Und wenn, dann nur unter größten Anstrengungen zugeneigt der eigenen Neugier, des eigenen Forschungsdrangs, aber gegen die Natur ansich?
Okay, der Vergleich hinkt. Ich schlief ein, wurde nachts nur ab und zu wach wegen des lauten Gequakes, das, keiner erkennbaren Regie gehorchend, mal aufflammte, dann wieder gänzlich erlosch; manchmal quakte ich mit.
Der gestrige Tag war wider Erwarten anstrengend. Ich hätte es wissen können, schließlich war ich die Rheinroute 2016 abwärtsgeradelt und ich erinnerte mich, dass die Etappe Schaffhausen bis Bad Zurzach selbst abwärts radelnd immer wieder Steigungen mit sich brachte. Thur und Töss sind zu überwinden. Die Gegend ist zerklüftet. Zwischen den beiden Flüssen, die nur wenige Kilometer von einander entfernt in den Hochrhein münden, befindet sich ein Hügelmassiv namens „der Irschel“. Die Dörfer heißen oft mit Beinamen „am Irschel“.
Tagsüber gab es zudem Netzwerkprobleme. Meine Schweizer Simkarte wollte und wollte nicht funktionieren. Selbst Telefonie war nicht möglich, weshalb ich in Hohentengen auf deutscher Seite einlief, mich bei der Kirche breit machte, versuchte, das Kommunikationsproblem zu lösen, bzw., Frau SoSo eine Nachricht zu senden, dass ich wohlauf bin und es nur ein technisches Problem gibt. Nichts ging, auch in Hohentengen nicht. Ich kaufte ein, startete einen letzten Versuch, scannte nach Drahtlosnetzwerken ohne Passwort, fand eins, und obschon es nicht meine Art ist, mich in unbekannte, womöglich unsichere Netzwerke einzuloggen, loggte ich mich ein, bestätigte die AGB – einer Technikfirma, war drin, konnte entwarnen.
Und nun? Zurück in die Schweiz erst einmal. Vielleicht hilft ja die Kur in Deutschland, mein Schweizer Netzwerk zu heilen?
Geduld zahlt sich in technischen Dingen oft aus. Nach zehn, zwanzig Kilometern, ohne mich um das Problem zu sorgen, bimmelte plötzlich der Kurznachrichtendienst und da ich die Schweizer Karte eingestellt hatte, konnte es sich folglich nur um die Ankunft einer Botschaft handeln. Tat es. Ich war wieder da. Das Telefon funktionierte auch. ich rief M . aus Winterthur an, ob wir uns treffen. Winterthur ist ab der Mündung der Töss nur 14 Kilometer von der Rheinradroute entfernt, doch M. würde erst am nächsten Tag wieder daheim sein, gegen Mittag. Das hätte mich zu sehr aus dem Radelrhythmus geworfen.
Kennt ihr dieses Gefühl, voran kommen zu wollen, sei es noch so langsam. Da stört dann jedes Verharren, das nicht der eigenen Regeneration dient. Jene Art böses Verharren, das Warten bedeutet.
Wir verabredeten uns also für ein Andermal, M. und ich.
Gegen neun Uhr abends erreichte ich den Rheinfall, passierte eine Drehschranke, lief den kurzen Rundweg links des Wasserfalls bei der Burg Laufen. Der Rheinradweg führt direkt am Wasserfall vorbei. War fast alleine. Noch ein Liebespaar und noch ein Liebespaar. Beim ersten fotografierte sie den Rheinfall, bat ihn, das Bild zu verlassen, beim zweiten fotografierte er sie vor dem Rheinfall. Ich durchlief den Parcours. Den Wasserfall so still und fast menschenleer zu erleben, hätte ich nicht gedacht. Beim letzten mal, 2016, passierte ich die Touristenattraktion nachmittags. Frittenbude, Asian Food, Leckeis, Souvenirs und in der Burg, unweit des Drehkreuzes (ich kann mich nicht erinnern, ob das damals schon existierte), war ein Areal mit Blenden abgeschirmt, hinter denen ein medizinisches Team eine Wiederbelebung machte. Polizei und Hektik, schnell weg.
Ich schreibe diese Zeilen am Rheinufer sitzend gegenüber der deutschen Exlave Büsingen. Wieder so eine Insel, denke ich. Eine künstliche Insel, mit Grenzen von Menschenhand gezogen. Wie sich wohl die Pandemische Grenzschließung auf den Ort Büsingen, der ja faktisch mitten in der Schweiz liegt, ausgewirkt hatten?
Ich befinde mich in der Schweiz. Auf meinem Handybildschirm werden übrrigens Ortsbezeichnungen wie „Paradies“ und „Neuparadies“ angezeigt.