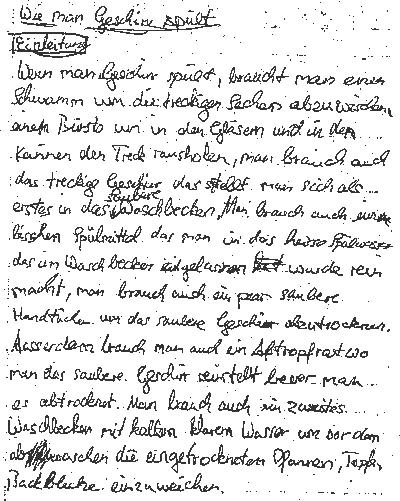Calais haut mich schier um. Alles stimmt. Auf einer ruhigen D940 rolle ich auf ebener Strecke bei bestem Sonnenschein in die Stadt. Kühl, aber Wohlfühlwetter. Die Seeluft tut gut. Schon von Weitem sehe ich riesige Pötte im Hafen liegen, von denen auf drei Ebenen über Rampen LKW, Busse, Autos rollen. Ob ich zu spät bin? Eine Drehbrücke, die für zehn Minuten oder mehr ausschwenkt, um einige Boote durchzuschleusen, gibt mir die nötige Ruhe.
Schicksal, Junge, kommste heute nicht rüber, dann halt Morgen. Der Hafen ist nah, aber ich muss zunächst einen Kilometer an einem Zaun entlang fahren, durch zwei riesige Kreisverkehre eine Acht radeln, bis ich am Ticketschalter von P&O bin. Dort kaufen gerade drei weitere Radler ihre Tickets, sowie zwei alte Männer und zwei deutsche Motorradler. Wir reden über das Wetter. Die Jungs mit den Fahrrädern kommen aus Kent, aus Canterbury, das auf meiner Strecke liegt. Nach den Tickets gehts über Windungen zum Zoll, erst französisch, dann englisch, ist man gar nicht mehr gewöhnt, als „Kontinenter“, dass es Grenzkontrollen gibt. Dann Ticketprüfbarriere. Wir schlängeln uns zwischen zig Reisebussen hindurch zu Spur 28, wo ein Harleyclub Angst einflößt mit Bärten und Tattoos – die beiden deutschen Motorradler wirken dagegen wie Lämmer. Am beunruhigendsten ist jedoch eine Gruppe Mittzwanziger, die schwarze Jacken tragen, auf denen England steht, und orangene T-Shirts und bunte Holzschuhe. Betrunken sind sie auch. Was ist daaaas denn? Bei näherem Betrachten schrumpft die Gruppe mutmaßlicher Hooligans zu einem Reisebus voller Holländer auf dem Weg zu einem Rugby-Turnier in Bristol. Wobei alle Altersklassen, Männer, Frauen, Kinder, vertreten sind. Irgendwie herrlich – ein Abbild einer europäischen Nation und deren repräsentative Gesellschaft in Busform. In der Fähre schallen die Holzschuhe. Das Säbelrasseln des kleinen Mannes. Mir wird klar, dass es pure Psychologie ist, wie wir Menschen in Gruppen auftreten. Gruppen geben dem Schwachen Macht, fangen den Ängstlichen auf, geben dem Schäbigen die Möglichkeit, sich auszutoben, ermöglichen dem Gehemmten, seine Hemmung zu verlieren und so weiter und so fort.
An Bord kaufe ich im Shop einen Stromadapter. Der muss für England drei Nasen haben und zwar flache, statt runde. Sind Schweizer Steckdosen nur einen Millimeter kleiner, als die deutschen und kann man mit viel Anlauf den Stecker einfach reindrücken, ist in England alles anders. Tatsächlich! Wie die drei Radler mir erzählen mit einem seltsamen Lächeln auf den Lippen. Pass auf, hüte dich soll das wohl heißen und ich lache noch, aach, kann doch nicht sein, wir sind doch alle nur Menschen. Klausbernd, den ich in Norfolk besuchen werde, kommentiert in einem Beitrag zuvor ebenso: „everything is different“. Natürlich: die Straßenseite. Das Pfund. Äußerlichkeiten.
Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt, auf welchem Deck mein Fahrrad steht. Aber hier kommen mir die holländischen Holzschuhe zu Hilfe. Da ihr Bus direkt neben dem Rad steht, muss ich nur dem Geklacker folgen. Blind könnte ich so mein Deck wieder finden.
Raus. Alles anders. Die Cycleroute 1, der ich die nächsten 2000 km folgen möchte, ist ab Hafen ausgeschildert. Eine Alternativstrecke nach Deal, etwa 10 Meilen entfernt, endet vor einer Treppe, wo ich das schwere Rad nicht hochtragen will. Also den Umweg über Dover nehmen. Dort fallen mir als erstes die Bettler auf, die wie ein Rosenkranz in schmutzigen Ecken an der Straße sitzen. Einer redet mit sich selbst, und ein ansich normal wirkender Kerl redet mit den Möwen. Ansonsten finde ich Durchschnittsmenschengesellschaft vor, von groß bis klein von jung bis alt, wie man sie in jedem holländischen Reisebus voller Rugbyfans im Modell vorfindet.
Außer: Radler steigen offenbar vom Rad, wenn es heißt, dass man absteigen soll und schieben. Die 1 führt über eine 13%-Steigung an Schloss Dover vorbei, hinauf zu den berühmten Klippen, dann über schmale Pfade, die betoniert sind an der Küste entlang Richtung Norden. Ich Schussel lese den Zettel nicht so genau durch, auf dem die Campingplätze gelistet sind. Irgendwo steht Deal und Camping, also sage ich mir, ich fahre bis Deal und gehe dort auf den Campingplatz. Dass der Platz aber an der Landstraße Richtung Deal liegt, x Meilen davor oder dahinter, auf der linken oder rechten Seite, das kann mein adressgewohntes Hirn nicht wahrnehmen. Wir Deutschen bzw. wir „Kontinenter“, denken in Punkten. Die Engländer denken in Linien?
In Deal stelle ich noch einen Unterschied fest: Die Engländer sprechen gar kein Englisch! Zumindest nicht das Internet-Englisch, das man als Deutscher gewohnt ist. Ich habe höllisch Schwierigkeiten, die Leute zu verstehen. Und sie mich. Eine einfache Frage – wo bitteschön geht es hier zum Bahnhof (Analogie Monty Python)? – kann in einer Katastrophe enden. Ich muss an meine alte Englischlehrerin denken, Frau Dr. Cronenberger, die uns des Öfteren gequält hat mit den verschiedenen Dialekten und Cockney und Pidgin und American English. Gosh! Mal durch die Nase reden, mal in der Kehle.
In Deal buche ich mich, wegen des eisigen Winds, der mir die letzten zwei Stunden auf die Stirn bretzelt bereitwillig für 50 Pfund im Beachbrow ein. Ich verbiete meinem Hirn, das in Euro umzurechen. Die Lernkurve kommt mir in den Sinn, eine betriebswirtschaftliche Kennlinie, die über den Verlauf des Gewinns und des Nutzens neu geschaffener Produkte Auskunft gibt. Am Anfang, in der Erfindungs- und Produktionsphase eines Produkts, sind die Stückkosten ungleich höher, als in einer Phase, in der das Produkt schon am Markt ist, alteingesessen man einige Hunderttausend produziert hat. Die Entwicklungskosten sind dann abgeschrieben. Ich will mal hoffen, dass ich diese Lernkurve auch auf das neue, totally different England-Land anwenden kann, sonst bin ich jenseits von London schon pleite.