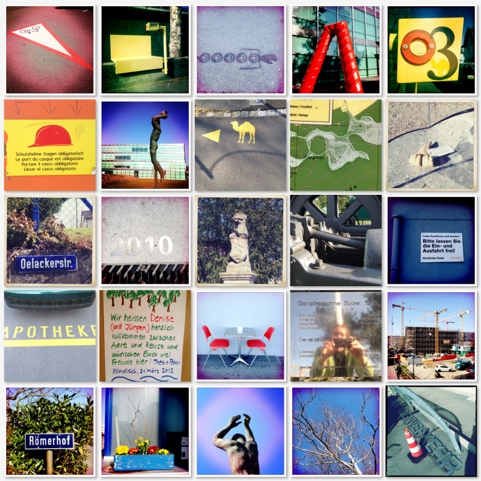Schon eine Woche her, dass ich den Zweibrücker Kreuzberg hinauf geächtzt bin. Nach fast vier Monaten Radtour um die Nordsee wieder daheim. Siebentausenssechshundertnochwas Kilometer, drei Platten, ein Tretlager, zwei Beinahestürze, ein beinahe Unfall, selbst verschuldet, zwei kritische Überholmanöver, viel Straßenlärm um viel. Und Stille.
Die Künstlerbude auf dem einsamen Gehöft ist eingestaubt. Überall Spinnweben. Ich muss an den Minicamping in der Nähe von Harlingen denken, wo die Tür zur Damentoilette mit einer Spinnwebe versiegelt war. Mann war da das Wetter schlecht.
Die Künstlerbude hatte ich zum Glück vor der Reise aufgeräumt, was sonst nicht meine Art ist. Das Auto hat keinen Tüv mehr. Derjenige, der es reparieren soll ist für drei Wochen krank. Der Internetanschluss funktioniert nicht mehr. Lebensader der Informationsgesellschaft. So verbringe ich die ersten Tage daheim damit, das Netzwerk zu reparieren, suche bis gestern, wie so oft, die Schuld bei mir selbst, bis ich erkenne, dass es ein Anschlussproblem ist, bzw. ein Problem an den Kompetenzgrenzen, jener Grauzone zwischen selbst und den anderen.
Eilvorbereitungen für das Kunstzwergfestival, welches am Wochenende 20-30 Dauergäste auf die Wiese hinterm einsamen Gehöft gespült hatte.
Welch krasser Lebenswechsel zwischen vier Monaten alleine, langsam, leise und dem Getümmel eines Kulturfestivals. Mit meinem bissig humorigen Freund Journalist F. scherze ich, telefonierend auf das Maisfeld hinter dem Küchenfenster blickend: diese Künstler sind wie Zombies. Wenn es dämmert erheben sie sich, die Arme nach vorne gereckt aus dem Maisfeld und du kannst verflixt nichts dagegen tun. Sabbernd die Zähne fletschend kommen sie langsam auf dich zu. Das Lächeln am Ende der Leitung. Drei ebenso schöne, wie bizarre Festivaltage – versteht mich nicht falsch, wenn ich vom Zombiebild rede. Es hatte sich mir einfach aufgedrängt, ebenso wie der etwas plumpe Spruch: Ein Kunstler macht muh, viele Künstler machen Mühe. Der stimmt. Und die Mühe ist es wert. Samstagsfrüh nach dem ersten Festivalabend spülen SoSo und ich das Geschirr vom gemeinsamen Essen am Vorabend und wir prägen den Spruch vom Freispülen: jetzt ist das Chaos noch nicht zu groß. Wer jetzt spült, wer sich jetzt nassforsch aus dem Kollektiv löst, kann sich freispülen und muss an den nächsten Tagen nichts mehr tun für die Gemeinschaft. Denkste! Aber der Freispüler war geboren. Schon skizziere ich, Teller trocknend einen Spülkurs und Spülhosen, auf die man gestickte Etiketten nähen darf. Nach dem Freispüler kommt der Fahrtenspüler. Es gibt das Seespülchen für die Kleinen und den Totentopf für die Mutigen. Nachmittags, verspreche ich, mache ich einen Kurs Freispüler. Die Kriterien, nach denen man das Abzeichen kriegt, sind 15 Minuten Spülen und ein Kopfsprung ins Spülbecken. Die Zeit rennt. Samstags feiern SoSo und ich drei Jahre Liebe. Ich glaube, SoSo sagt, drei Jahre schon, bzw. drei Jahre punkt punkt punkt, mit diesem sehnsüchtig unergründlichen Schwingen in der Stimme, das den Moment zur Ewigkeit erstarren lässt. Und mir schießt es in den Sinn: Erst? Nicht etwa, weil mir die Zeit so lang vorkommt, sondern weil so viel passiert ist. Ich sehe uns gleichzeitig am Polarkreis, in den Pyrenäen, in Bern, in Zweibrücken – wie viele tausend Kilometer mussten wir fahren, um einander immer wieder zu erreichen, zwischendrin lebten wir ein ganzes Jahr zusammen … höchste Höhen, tiefste Tiefen. Das alles kann nie und nimmer in nur drei Jahren passiert sein. Um uns das Getümmel der Welt.
Die Nordseereise ist siebentausendsechshundertnochwas Kilometer entfernt. Ach was, es fühlt sich, nun montags, dies schreibend, so an, als habe sie niemals stattgefunden. Als habe ich das einsame Gehöft nie verlassen. Ausradiert. Was bleibt, ist eine Slideshow auf dem Computer, die eine zur Fiktion werdende Vergangenheit abbildet.
Im Notizbuch des Fons finde ich einen nicht veröffentlichten Tourenbericht mit dem Titel: „Der letzte Kreuzberg – Ausrollen auf dem weichen Teer des Alltags“.
Er handelt von einem Mann mit 50 kg schwerem Fahrrad, der nach vier Monaten Radeltour die steilste Straße seiner Heimatstadt hinauf kurbelt.
Vollmond der feinen Künste
Junge, lass den Clown weg! Das blockiert Dich nur.
Wenn ich bloß unterwegs schreiben könnte, dann, wenn die Gedanken in Form von einzelnen Worten, Satzfetzen, ja, ganzen Passagen entstehen. Umblasen von Wind, zerschossen von Sonne, überdacht von Wolken, durchwirkt von Regen, kurbelnd ohne zu realisieren woher, und wohin die Reise geht, entsteht in mir manchmal ein kleines, brüchiges Wort-Universum, das so instabil ist, dass es schon beim nächsten schiefhängenden Briefkasten hinter einer vom Wind zerzausten Kiefer in sich kollabiert und dahin geht, woher es kam. Ins Nichts meiner Gedankenwelt.
Fotografisches Schlachtfest. Kasum vier Kilometer nach dem Start geht es im Dorf Voersaa los. Ein Kerl in Latzhose kümmert sich liebevoll um ein Stück Wiese neben seiner Garage, hat einen Schubkarren voller Gras neben sich stehen und den Rechen, wie von Joseph Beuys arrangiert, daran gelehnt. Fehlt nur noch die Fettecke und das Ding kann ins Museum. Ich frage, ob ich fotografieren darf, und er nickt stirnrunzelnd. Ich erzähle ihm, dass wir zuhause sieben Schubkarren haben, eine Marotte des Überflusses, aus Mangel geboren, drifte um die Ecke weiter, weiter, weiter und erlebe an diesem Morgen ein Dorado der schnellen Schnappschussfotografie. Plötzlich ist alles bunt, alles wichtig, alles interessant. Solche „Läufe“ ereignen sich manchmal, aber auch die Gedanken schlagen Purzelbäume. Mit dem „Material“, das ich in den folgenden Kilometern erknipse, könnte ich einen Bildband füllen: eine Serie von 16 Wandgemälden an der Mauer des Museums in Voersaa, von Kindern gemalte Chronologie der dänischen Könige und Königinnen. Schon sehe ich eine fertige Bildtafel vor mir. An der Tür des Heimatmuseums, das in einem ganz normalen Haus untergebracht ist, hängt ein Schild mit der Aufschrift: Wenn die Tür auf ist, ist das Museum geöffnet, wenn die Tür ikke (nicht) auf ist, ist das Museum geschlossen. Die haben Humor.
Die Flut an Bildern spiegelt sich in meinem Innern wieder, so dass ich auf der ruhigen Strecke nach Fredrikshavn immer wieder das Fon herauskrame und Skizzen aufs Band rede. Schnurgerade Strecke. Man fährt bedacht … bis auf … wie aus dem Nichts schießt in einer Sechziger Zone ein Taxi an mir vorbei mit hndertzwanzig plus X. Au Backe. das hätte können schief gehen. Der Druck des Fahrtwinds umwirbelt mich, so dass ich mich frage, wieso diese unsichtbaren, kaum spürbaren Windatome nicht ungebremst durch mich hindurchjagen. Ist doch wohl genug Platz zwischen den Künstleratomen, aus denen ich bestehe. Ich werde noch wahnsinnig in disem Land, das in meiner Vorstellung eine riesige Wanderdüne ist, die sich mit dem Wind nach Osten wälzt. In hundert Jahren ist Dänemark vielleicht schon in Schweden, scherze ich innerlich – das wäre ein Beitrag, der mal wieder mit einem Clownfrühstück und einem „Liebes Tagebuch“ beginnen könnte.
Dem Taximännlein dichte ich nebenbei eine Geschichte an, dass er eine hochschwangere Frau im Kofferraum hat, die er nach öhm, mist, das Krankenhaus liegt in die andere Richtung, in Fredrikshaven eigentlich, die Geschichte hinkt, egal, die Puppe will nach Kopenhagen ins Krankenhaus, und deshalb jagt der Taxifahrer mit hundertzwanzig Sachen nach Süden. Plötzlich überholt mich ein Feuerwehrauto mit auch über hundert, ohne Blaulich, was mir aber egal ist – auch diese Fahrtwinddruckwelle trifft mich mit Wucht, aber irgendwie passt das zu meiner hanebüchenen hochschwangeren Taxigeschichte, denn die Frau hat ihr Teelicht brennen lassen, welches nun das Häuschen am Stadtrand von Fredrikshavn entzündet hat, ach, Herr Irgendlink, wie hanebüchen sind deine Geschichten. Feuerwehrauto im Einsatz ohne Sirene und Blaulicht, das glaubt dir doch niemand! Doch, so wars, ich schwörs. Mein Eid. Die Feuerwehren in Dänemark haben kein Blaulicht und Sirene, weil hier so wenig los ist. Sie sausen einfach durch dich hindurch und du merkst gar nix davon. Jawoll.
So treibt mich der Südwind nach Fredrikshavn. Das ist ein Fall fürs Clownfrühstück. Dieser Tag. Diese Situation, denke ich und formuliere am Stadtrand eine Geschichte mit einem Clown namens August-mit-A-mit-Kringel-drauf, der mal wieder so dumm ist, dass er mir ins Netz ging und ich ihn zum Frühstück verspeist habe. Seine Schuhe waren ein Yard lang und ich habe sie zu einem Kreuz geformt am Straßenrand aufgestellt.
Fredrikshavn ist die größte Stadt Norddänemarks. Gewitter jagen mich hinein. Es gelingt mir, über dreißig Kilometer weit, den Schauern auszuweichen, mich an Tankstellen unterzustellen, in Straßencafés abzuwarten, in einem Laden so lange einzukaufen, bis ein Hagelschauer das kurze Stück über die begrünte Sanddüne, auf der ich radele Richtung Nordosten überquert hat. In einem Schönpuppenkleiderlädchen kann ich eine Weile rumlungern, auf Einladung der Besitzerin. Ich helfe ihr, die Kleider, die sie vor der Türe stehen hat, hinein zu tragen, um sie vor dem Schlagregen zu retten. Etliche Damen im Laden, junge Frauen um dreißig, die sich die vorwiegend in rosa gehaltene Mode betrachten, ein bärbeißiger, nicht sehr amüsierter Kerl reicht seiner Freundin ein Kleidungsstück nach dem anderen. Ich mag den Laden. Die Besitzerin schenkt mir einen Spratz Kaffe ein – die Kanne ist leider fast leer. Es gibt Lebensmittel von hoher Güte, Tee, Kaffee, Gewürzöle, Geschenkartikel und Kleider. Ein sehr spezieller Stil, der die Touristinnen, die auf dem Weg nach Skagen sind, wie eine Aalreuse anzieht, sie fängt, sie erst wieder entlässt, wenn sie ein wenig Geld dagelassen haben. Bis vier Kilometer vor Skagen radele ich dank dieses geschickten Regenschauer-Hoppings im Trockenen, nur, um bei einer versandeten Kirche, von der nur noch der Turm zu sehen ist, im Schlagregen zu enden. Alle Kleider an, auch die Neoprengamaschen, komme ich in die Stadt, finde Rays Jugendherberge, stehe vor verschlossener Rezeption. Kaum zu glauben, die machen um 17 Uhr schon dicht. Da es mir wegen rauchender Zeitgenossinnen, die mürrisch vor der Tür stehen, nicht sonderlich attraktiv scheint, suche ich nach Campingplätzen. Wildzelten fällt flach. Die Gegend wirkt gut bewacht, naturgeschützt – überall um die Stadt sind Camping verboten-Schilder aufgestellt, Waldbrandgefahr, Hunde an die Leine, Privat … es gibt zwei Campings nördlich der Stadt, von denen ich den nördlicheren anpeile. Der regen lässt nach. Ray schreibe ich eine SMS. Seit Stavanger habe ich ihn nicht mehr getroffen, aber wir haben stets unsere jeweiligen wo-sind-wirs geteilt. Ich war immer ein bis drei Tage hintendran.
Nach dem Duschen steht sein Radel neben meinem Zelt und ich treffe ihn im TV-Raum, wo wir das neueste austauschen, beschließen gemeinsam weiter zu radeln am nächsten Tag. Ein Berliner Radler namens „Rute“, Rastaman, der gegen den Uhrzeigersinn um Dänemark radelt, gibt uns Tipps zu den „Shelters“. Das sind Biwackplätze mit hölzernen Verschlägen, in die man gerade so reinpasst zum Schlafen, Achtzig Zentimeter hohe Kabäuschen. Über tausend Stück gibts davon in Dänemark. Sie kosten 25 Kronen pro Nacht, wobei es schwer ist, das Geld zu entrichten, weil niemand da ist, dem man es geben könnte. Rute hat ein Buch, in dem auf dänisch die Shelters beschrieben sind und in einer Karte eingetragen sind. Drei heiße Tipps notiert er uns auf einen Zettel: Nummer 9, Nummer 63 und dann noch jenen, bei dem man aus dem Kabäuschen direkt auf die Nordsee schaut. Vorsorglich fotografiere ich die Karte und das Symbol, mit dem die Dinger auf Hinweisschildern gekennzeichnet sind. Die geheime Zwischenwelt halbhoher spartanischer Übernachtungsgelegenheiten, quasi Gleis Zweieinhalb von Dänemarks Campingwelt.
Die Dichte des Tages mit all seinen Erlebnissen und Bildern, lässt mich nachdenken über die Vermutung, dass Kunstschaffen und Schreiben einem unsichtbaren Zyklus folgt, ähnlich wie Mondphasen, und dass es gilt, die Durstphasen, in denen „nichts kommt“ ebenso zu meistern, wie die Überflussphasen, in denen fast zu viel ist. Fürs Liveschreiben eine enorme Herausforderung – wie halte ich einen splatterhaften Artikel, der sich aus der Vielfalt von Erlebnissen, die fast alle gleichzeitig auf einen herniederprasseln, zusammen, so dass er eine wohlige Form bekommt?
Klausbernds Anmerkungen in den Artikeln zuvor, das eine nachträgliche Überarbeitung der Einträge in diesem Liveblogbuch wihtig ist, kommt mir in den Sinn. Jawohl, so muss es sein. Und gleichzeitig darf man dem Proagonisten auch zuschauen bei seiner Operation am offenen Herzen der Literatur. Jetzt.
(sanft redigiert und gepostet von Sofasophia)
Windisch le Schön
Der Mensch, in Zerlegung begriffen
Es ist schwierig, die Ereignisse der letzten Tage in Worte zu fassen. SoSo und ich haben unsere Leben in Einzelteile zerlegt. Sehr bildlich: das Auseinandernehmen der Wohnung in Zweibrücken und das Verpacken in Kisten. „Ein Umzug ist nichts anderes, als die Simulation eines Todesfalls bei lebendigem Leib“, schießt es mir in den Sinn. Plötzlicher Zusammenbruch des Gewohnheitskonstrukts des Alltags, das einem Halt gibt und Sicherheit, und dann: auf in ein neues Land.
Was war ich aufgeregt, mit dem völlig überladenen 3.5-Tonner, als wir gestern die Grenze bei Rheinfelden passieren, auf einem riesigen Parkplatz voller LKWs mit Gütern von Irgendwo nach Irgendwo festhängen, Gedränge und Hektik, knapp eine Stunde Formalitäten und Papierkram, durchgewinkt und hinein in das herrliche Land, in dem alles so schön sauber ist und aufgeräumt. Aufgeräumter und sauberer noch, als bei uns. „Ich möchte ein Schweizer sein, am kalten Polar“, schießt es mir in den Sinn, treu dem NDW-Song, von wem noch? „Jadell-Dadell-remm-remm-remm“.
Jede Menge Freundinnen und Freunde von SoSo helfen beim Ausladen von exakt 11 Kubikmeter Transporter. Bemerkenswert ist die seltsame Art der Kommunikation, wenn vier fünf Leute im Hin- und Herlaufen reden, die einander nur über den Sechsten kennen, der alle einbestellt (ne, freundlich gebeten) hat, beim Umzug zu helfen. Mit den einzelnen Kisten, die man schleppt auf den zwanzig Metern zwischen Haus und Auto, transportiert man auch immer ein paar Worte: „Gehts? Kann ich dir helfen? Ist das nicht zu schwer? Woher kennst du eigentlich SoSo?“ So trägt man mit jedem kleinen Lastenpäckchen auch ein bisschen Information. Ameisen sind wir.
Tags drauf, heute, richten wir die Bude ein, eine urige Erdgeschosswohnung aus Holz und gegen 14 Uhr trudelt eine SMS ein, die mir beinahe den Tag ruiniert: der Telekommunikationsanbieter droht mit Abschaltung, wenn ich nicht sofort die überfällige Rechnung bezahle. herrjeh. Die letzten Wochen waren ja so intensiv, dass ich glatt alles und das Allerichtigste auch noch vergessen habe. Ich bin kurzum urlaubsreif. „Sofort!“, steht in der SMS, heißt heute.
Kurz nach 23 Uhr, wieder daheim, rufe ich demütig die Hotline des Telekommunikationsanbieters an und genehmige eine Lastschrift. Hatte ich sowieso vor, wegen des Ums Meers. Was ist der Mensch in Zerlegeung doch so angreifbar. Unkonzentriert. Auf herrlich natürliche Weise schludrig. Ich finde, man muss dazu stehen. Der Mitarbeiter an der Hotline ist sehr freundlich und äußerst verständnisvoll, will mir aber nichts garantieren. Mit korrekter Bestimmtheit gibt er mir zu verstehen, dass mir die Schlinge schon um den Hals liegt.
Aber auch positive Dinge: langsam werden die Finger einer Hand knapp, an denen ich die Zahl der SponsorInnen für Ums Meer abzählen kann. Morgen werde ich endlich an der SponsorInnen-Sektion arbeiten können und die Übersetzungen für das Projekt einbinden können.
Der hießige Offene Kanal möchte einen Fernsehclip über das Projekt drehen … es kommt mir vor wie Klettern. Der Halfdome der feinen Künste, tausend Meter hohe Steilwand der modernen Blogliteratur. Alles Leben ist Kelttern. Suchen nach selbst noch so wenigen Trittmöglichkeiten, Vorsprüngen, Absätzen, gut verkeilbaren Rissen, in denen man sich empor ackern kann.
Verzicht
Beim Ausstellungsbauen sind insbesondere die Konzeptkunstgeschichten wahre Ideenquellen, so dass ein gedachtes Projekt immer größer ist, als das, was am Ende tatsächlich zu sehen ist. Ist wie Eisberg. Das Meiste verbirgt sich unter der Wasserlinie. Da eigentlich immer zu wenig Zeit ist, um alle Ideen umzusetzen, habe ich schon vor langer Zeit eine Art Schichtenmodell des Ausstellungsbaus entwickelt, welches zwiebelschalenähnlich theoretisch alles umsetzbar macht, was das Künstlerhirn sich einfallen lässt. Theoretisch. Wegen Zeitmangels verzichte ich fast immer auf Feinheiten. So funktioniert es auch mit dem Putzen der Künstlerbude, der ich heute wegen Damenbesuchs mit Eimer und Lappen zu Leibe rücken musste. Theoretisch wäre Pikobello möglich gewesen. Aber da ich der Dame, SoSo, auch beim Umzug helfen wollte, hab ich die Ecken generös übersehen. Nun ist SoSos Wohnung ins Umzugsauto verpackt und sie haust bei mir in der Künstlerbude.
Ich sollte verzichten, nächsten Montag auf die Reise ums Meer zu starten. Manchmal denke ich, ich sollte ganz auf die Reise verzichten. Hab mal wieder drei Leben in eins gepackt. Das ist Kräftezehrend bis mörderisch.