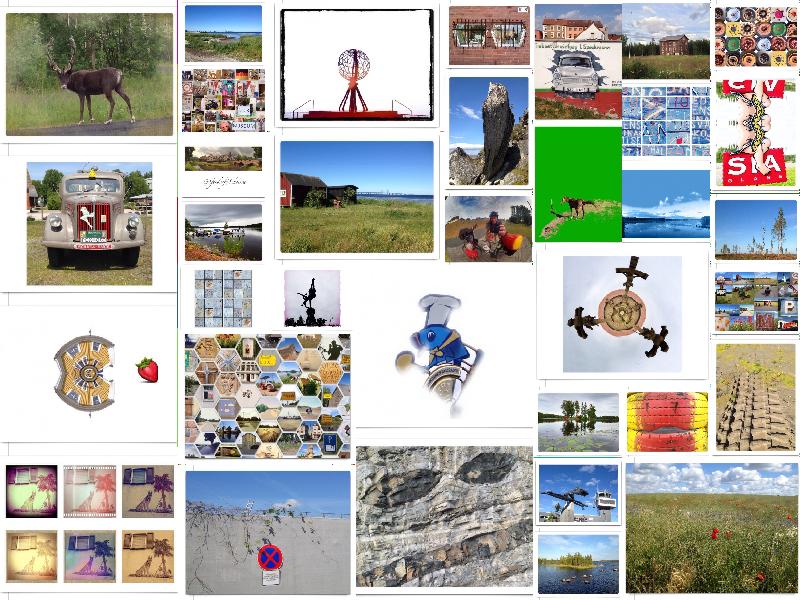Ein Spaziergang im Wald am gestrigen, brilianten Sonntag. Wir sammeln Birkenrinde zum Feueranzünden. Daheim tauen die Grillwürste auf, die beim Wintercamping mit Freunden Ende Februar noch übrig geblieben sind. Offizielles Angrillen. Frau SoSo fragt, was ich mir bei einem Blogartikel, den ich kürzlich geschrieben habe, gedacht habe; wie ich auf diesen oder jenen Gedanken kam. Ich weiß nicht mehr, um welchen Artikel es ging. Ich antworte spontan, ich habe gar nichts gedacht. Ich denke nicht. Es denkt in mir und ich bin mir nicht sicher, ob es mich als Ich überhaupt gibt. Die Bezeichnung Ich für sich selbst ist doch nur ein Notbehelf für etwas, das man bezeichnen muss, das man aber nicht erklären kann. Das mag verrückt klingen. Durch jungkeimendes Grün stapfend, unter umgestürzten Fichten hindurch limboisierend, bin ich plötzlich ziemlich perplex und denke, der Ich heute ist ein Anderer als der Ich vor ein paar Jahren und als der vor zig Jahren und wieder ein Anderer als der Baby-Ich. Fast wie ein kleiner Freispruch, dass wir alle einmal als gute Menschen auf diesem Planeten begonnen haben und die Zeit formt uns zu dem, was wir in der jeweiligen Gegenwart sind.
Plötzlich vibriert das Telefon. Mein Freund, der Automechaniker J. ist dran, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise rufe ich ihn an, weil ich irgendwelche Schrauberkniffeleien lösen muss, aber die letzten beiden Male, geht die Kontaktaufnahme komischer Weise andersrum. Vielleicht haben wir die Grenze von der Zweckgemeinschaft zur Freundschaft überschritten? Die Grenze zur Schweiz wird dicht gemacht, sagt er, habs gerade im Liveticker gesehen, du solltest das wissen, bist du in der Schweiz? Nein, die Schweiz ist bei mir. Frau SoSo wird hellhörig und hier, so im kraftstrotzenden Wald, der sich gerade wieder aufrappelt von den Winterstürmen, herrscht plötzlich in zwei komischen Ichs, die sich auf Füßen fortbewegen eine klamme Stimmung. Wie? Was heißt das, Grenze dicht? Keiner rein, keiner raus? Darf Frau SoSo noch in die Schweiz einreisen und falls ja, darf sie durch Frankreich fahren, oder muss sie den Grenzzipfel bis Karlsruhe umfahren, sich auf die mörderische A5 begeben, last Exit Basel …? Fragen über Fragen, die sich die massenhaft getöteten Bäume, die kreuz und quer liegen, sicher nie gestellt hätten.

Ein Baum-Ich, das wäre mal etwas. Leben und empfinden wie ein Baum. Ich stelle mir das sehr selbstzufrieden, vielleicht ein bisschen fatalistisch vor. Du kannst als Baum selbst in tausend Jahren deinen Standort nicht wechseln. Der 1111 Jahre alte Olivenbaum nahe der Pont du Gard kommt mir in den Sinn, den wir um Weihnachten schon zum zweiten Mal besucht haben. Von seiner Position am Nordufer des Gardon hat man einen schönen Blick auf das Römeraquädukt. Was dieser Kerl alles gesehen hätte, wenn er ein Mensch wäre? Das gesamte Mittelalter, die Renaissance könnte er berichten, vielleicht war sogar Goethe schon bei ihm? Er könnte über die dreckige Zeit der 1970er bis 2000er Jahre berichten, in der die schmale Departementsstraße noch über eine Straßenbrücke direkt neben dem Aquädukt befahren war, in der Scharen von Touristen ihre Autos wild am Straßenrand parkten in ausgefahrenen trockenen Buchten im Ocker zerriebenen Kalkkonglomerats. Wie oft man ihn wohl angepisst hat in den 1111 Jahren? Wieviele Familien unter seinen Zweigen ihre Picknickdecken ausbreiteten und Käse, Wein, Baguette picknickten? Ob er sich erinnert, dass wir auf den Tag genau fünf Jahre zuvor auch bei ihm waren? Da war er schon erlöst von der scheiß Departemenstsstraße. Seit etwa zwanzig Jahren ist das Bauwerk, das, so glaube ich, auch Welterbe ist, für den Publikumsverkehr neu geregelt. Die Straßenbrücke wurde um die Jahrtausendwende stillgelegt, ein Besucherzentrum mit angrenzendem Park errichtet. Man darfdas Gelände von Norden her nur noch mit Eintrittskarte betreten (von Süden kann man über die Wanderwege unkontrolliert zum Pont du Gard, zumindest außerhalb der Saison). Um diese Zeit muss auch jener erhabene Moment gewesen sein, als man ihm, dem Olivenbaum, einen Stein beiseite legte mit einer Metalltafel, auf der sein Alter eingarviert ist. Vielleicht waren Honoratioren anwesend und der Moment wurde gefeiert (von Menschen für Bäume, von Menschen für Menschen?) Ob es ihn juckt, den Methusalem? Ob er sich als Ich sieht?
Ich werde es nie erfahren.
Ich huste. Die Nase kitzelt. Der Hals kratzt. Hab ich den Virus? Schon seit Freitag geht das so. Ich hatte Freund Jounalist F. mal wieder beim Einkaufen geholfen. Als Dialysepatient ist er vier Mal die Woche außer Gefecht und obendrein nicht sehr mobil. Schon seit Oktober assistiere ich. Dieser Tage jedoch kommen mir Bedenken. Die Dialyse findet im größten Klinikum hier in der Gegend statt. Tausende Menschen arbeiten auf dem vielhektargroßen Gelände. Eine kleine Stadt am Rande der Stadt. Ich erinnere mich an die Zeiten der Vogelgrippe vor etwa zehn Jahren, als man an den Pforten zum Gelände Schilder aufstellte: Wenn sie aus Land A, B oder C kommen und Symptome haben, melden Sie sich da und da. Im Laufe der Zeit wurden die Schilder immer größer und zu Land A, B und C, gesellte sich Land D, E, F und so weiter. Ich fand das bemerkenswert.
Schilder waren gestern. Heute sind es Liveticker.
Freitagsmorgens auf dem Weg zu Journalist F. hatte ich mir überlegt, ich sollte vorsichtig sein. Ich streifte eine Schutzmaske über, aber schon beim Freund in der Wohnung war klar, dass das kaum hilft. Es schütze ohnehin eher die Umwelt als einen selbst und da ich davon ausging, dass das Virus wenn, dann von ihm, der er täglich sechs Stunden im verkeimten Klinikum ist und mit weit herumgekommenen Taxifahrern unterwegs ist, zu mir springt, denn umgekehrt, ließ ich das mit der Maske wieder sein. Spätestens als Journalist F. schwindelte, er sich nicht mehr am Rollator halten konnte, in seiner Wohnung drohte zu stürzen und ich ihn mit beiden Armen unter die Achselhöhlen fassen und stützen musste und wir uns sehr nahe dabei kamen, wurde mir klar, ich kann es auch sein lassen mit der Maske. Ich bin sowieso nicht kompetent genug, sie fachgerecht anzulegen.
Ich setze die Waschmaschine auf, derweil sich Journalist F. ein wenig ausruht. Wegen der Plümeranz wird dem Freund etwas bange und er sagt, richte mal vorsorglich die Krankenhaustasche, vielleicht fahren wir da hin.
Weiter im Standard-Programm der Assistenz. Ich machte den wöchentlichen Einkauf in einem proppenvollen Aldimarkt – seit Oktober habe ich den Markt noch nie so hektisch erlebt, denke ich mir. Eine Frau neben mir am Pfandautomaten macht ein kleines Wettrennen und wir schmunzeln vor uns hin, 4,75, sage ich, 6,50, sagt sie, 7,75 kontere ich. Sie füttert fast ausschließlich anderthalb Liter Flaschen, während ich kleine Energiedrinkdosen einfülle und somit schneller bin. Mit satten 11 Euro gewinne ich knapp. Wie in einem Spiel ohne Gewinner verlassen wir den Automaten. Es ist fast wie eine kleine Blutsbrüderschaft.
Einkaufsliste abarbeiten. Normalerweise bin immer ich der, der den vollsten Wagen hat, aber nun sehe ich zig Menschen, die sich unendlich viel einladen. Trotzdem gibt es alles, was Journalist F. auf der Liste hat. Sogar Erdbeeren. Die Stimmung im Laden ist angespannt. Alle drei Kassen sind besetzt.
Draußen vor dem Laden steht der Hühnerfred. An der wie eine Hölle auf Rädern wirkenden Grillbude stehen einige Menschen Schlange, lechzenden Mundes auf die sich ruhig drehenden Hähnchen starrend. Hühnerfred steckt mit beiden Armen bis zu den Ellenbogen im Fett knusperbrauner Hühnerhaut. Selbst ohne die Pandemie im Nacken könnte ich aus purem Ekel vor den feinen Härchen seiner Arme, die sich gewiss ins eine oder andere Hähnchen verirren, nichts davon kaufen. Die Menschen, die anstehen, es sind nicht wenige, scheint das überhaupt nicht zu kümmern. Hasardeure, denen der Speichel in den Mundwinkeln rinnt. Ich sehe nicht, wie sie das mit dem Geld regeln, aber irgendwie müssen sie den Fred doch bezahlen und er muss ihnen wechseln und die Höllenbude sieht nicht danach aus, als wäre dort ein Waschbecken, in dem man mal eben zwei Vaterunser lang seine Hände waschen könnte.
Zurück beim Journalisten bin ich erfreut, ihn wieder munter zu sehen. Es ist nicht neu, dass sein Kreislauf zusammenklappt, das sei gesagt, aber eben, die Virussache macht einen etwas hysterisch und dann erkennt man nicht mehr, was sich als normal eingestellt hat an Gefühlen und Befindlichkeiten, und was durch die Angst, die einen ob der Nachrichten ergreift, aufgepfropft ist.
Abends danach, also vergangenen Freitag, erster Schnupfen. Hirn sagt sofort, Alarm. Halskratzen, trockener Husten. Samstags früh alles wieder bestens, bis sich das Hirn wieder auf den Schienenstrang der Hysterisierung begibt und hie und da ein Zwicken feststellt. Gibt es psychosomatischen Schnupfen? Husten, all das? Ich besinne mich im Laufe des Wochenendes, messe sogar erstmals seit zwanzig Jahren Fieber, 36,6, fühle Puls, entferne zwei Holzstücke, die ich im Verdacht habe, dass sie vom Rußrindenpilz befallen sind aus dem Brennholzstapel – denn die Suche nach Alternativen zum Virus, die den Reizhusten ausgelöst haben könnten, hat längst begonnen. Ohnehin, wird mir jetzt erst einmal bewusst, wie oft ich solchen Husten habe. Ziemlich oft. Sogar beim Staubsaugen der Künstlerbude kriege ich Husten. Meine Lunge ist einfach nicht mehr das, was sie einmal war. Und sie ist auch nicht das, was ich von ihr denke, was sie nun ist.
Es ist ähnlich wie mit dem, was in mir denkt und diese Zeilen schreibt, von dem ich nicht weiß, wer oder was es ist und wie es funktioniert, das aber einfach da ist und eigentlich keine Begründung bräuchte. Ja ja, ich glaube, das lässt sich tatsächlich vergleichen mit dem was man fühlt und wenn man Schnupfen fühlt und Husten, dann ist das zwar Schnupfen und Husten, aber welche Ursache sie haben, das verschließt sich einem, wenn man nicht in der Lage ist, einen Labortest zu machen.
So sitze ich denn hier am Montagmorgen vor der eigentlich hätte beginnen sollenden Radelreise nach Andorra und weiß nur eins, ich habe leichte Erkältungssymptome wie eigentlich öfter mal, die mich überhaupt nicht einschränken und weit davon entfernt sind, sich wie eine alles ausknockende Grippe anzufühlen. Ich ḱönnte sofort aufs Radel steigen, tja … die Grenzen sind dicht. Ich kann die Reise nicht beginnen. Wie zum Hohn baut sich das erste große Frühlingshoch über dem Land auf, aber es gibt Schlimmeres als nicht reisen zu können, denke ich mir. Andorra mit seinem einen Virusfall läuft mir nicht weg.
Freund Journalist F. dürfte aufatmen und froh sein, dass ich weiterhin assistieren kann. Obschon ich mich ganz und gar nicht danach reiße, das einsame Gehöft zu verlassen.
Pandemisch gesehen ist nämlich ein einsames Gehöft der perfekte Ort, um Zeit verstreichen zu lassen.
Ich sollte die Gartenanbaufläche vergrößern.