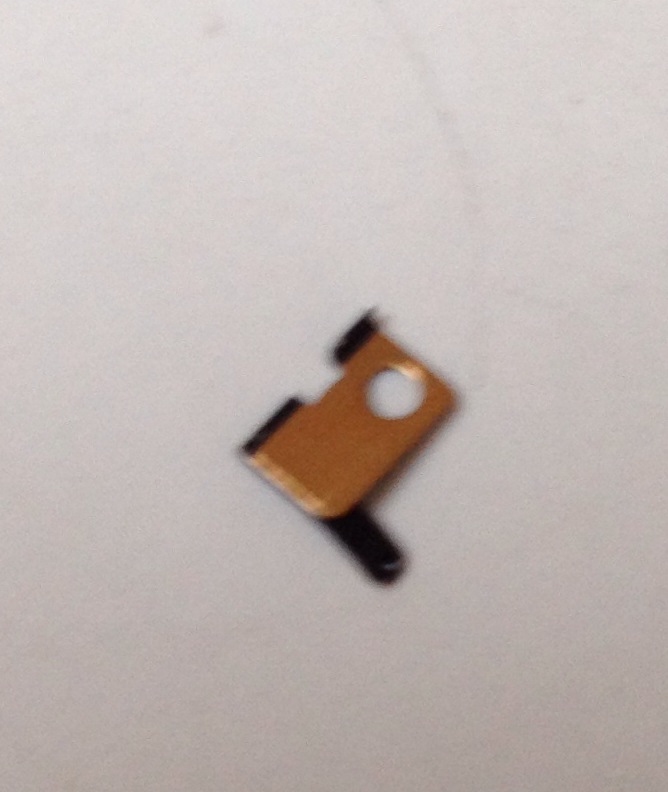Joseph sollte ich erwähnen. Wir erkennen einander an einem Dorfbahnhof. Er jenseits des Gleises, ich diesseits. Winke ihm zu. Er winkt zurück. Das ist nicht irgendso ein Passant, dem man beiläufig den Gruß erbietet, denke ich bei mir, radele weiter, fotografiere eine Hauswand. Da kommt er schon um die Ecke mit seinem Radel. Hat den Zug nach Kusel verpasst. Spricht Englisch, ist Amerikaner. Nein, kein Soldat, wie man hier in der Gegend um die Airbase Ramstein erwarten könnte.
Eher das Gegenteil. So eine Art Buddha. Auf der Suche. Mit den Jahren weise geworden, eine ruhige Seele im Einklang mit der Natur.
Wir radeln ein Stück und setzen uns dann auf eine Bank unter einer verdrehten Kastanie. Ein vergleichsweise junger Baum, nicht so wie die mehrere Meter durchmessenden alten Kastanien, die ich aus dem Tessin kenne.
Ich soll den Baum anfassen, mit ihm reden, erkennen, dass alles Eins ist, dass wir Lebewesen und auch die Steine miteinander verbunden sind und das ist mir ja schon auch klar, auf meine rationale Weise, aber ich kann das nicht fühlen.
Da lacht er, Joseph, erzählt von seinem Haus und seiner Fmilie und dass er fünf Jahre um die Welt gereist ist, Himalaya, Indien, auf dem Amazonas mit einem Hausboot. Nun leben sie hier und sind irgendwie anders. So dass es mit den Dorfbewohnern nicht immer einfach ist.
Fast wie wir Künstler, sage ich. Ja. Künstler sind so Wesen, die man beargwöhnt. Weil man sie nicht einordnen kann.
Künstler sind keine Bäcker. Sie sind keine Steuerfachgehilfen und auch keine Maurer. Sie lassen sich nicht einsortieren. Sie sind wie die Welt. Vieles in Einem und alles miteinander in Korrespondenz.
Joseph lädt mich ein in sein Haus, ich soll mir die blaue Sonne ansehen, die er über das Tor gemalt hat. Den Hahn namens Bob und seinen Buddha, der hinten im Garten in einem Schrein steht.
Ich kann Entschleunigung gut brauchen, also radeln wir zu ihm nach Hause.
Insbesondere am Beginn einer Reise ist es wichtig, den eigenen, inneren, enthusiastischen Schweinehund ein bisschen auszubremsen.
So lande ich in dem alten, verwinkelten Haus, das unheimlich gemütlich ist und mache einen Parforce-Spaziergang durch das Leben von Joseph und seiner Familie. Es erstaunt mich immer wieder, wie nahe man sich im Vorbeigehen kommen kann.
Ein Omelette? Du bist doch hungrig, fragt er. Ich auch, sagt er. Und legt los. Franzöische Art drei Eier, Wasser, Gewürze, dann Käse draufreiben und zusammenrollen.
Wir essen aus einem Teller, jeder von seinem Ende des Omelettes bis in die Mitte.
Dass ich darüber schreibe, erwähne ich in einem Nebensatz.
The Omelette Situation, sagt er.
Hey, und das ist doch ein guter Titel für einen Blogartikel. Hat was wie Pulp Fiction, nur unblutig.
Nun sitze ich hier, einen Tag später auf einer Bank zwischen Gensingen und Dietersheim. Das Handy liegt auf einem Betontisch. Kalt ist er und hinter mir in der Sonne brutzelt die Solarzelle zwei Zwischenakkus voll.
Heute will ich noch nach Mainz und möglichst noch weiter bis in die Gegend um den Windsor Weinberg, irgendwo am Main außerhalb von Kastel.